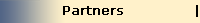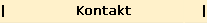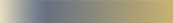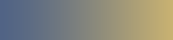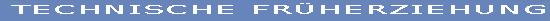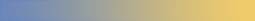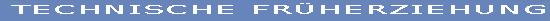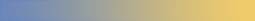Was hat das Lernen mit dem
Geschlecht zu tun?
Geschlechtsspezifische Unterschiede, Theorien über ihre
Ursachen und Schlussfolgerungen für eine Pädagogik, die beiden Geschlechtern
gerecht wird
Beobachtete Verhaltensunterschiede zwischen Mädchen und Jungen
Bereits bei Säuglingen sind erste
Unterschiede im Verhalten zwischen Mädchen und Jungen zu beobachten, diese
insbesondere in der Art der Kontaktaufnahme. Früh differenzieren sich geschlechtstypische
Spielinteressen heraus. So ist schon bei Jungen im Alter von ca. zwei Jahren
ein hohes Interesse an großen Spielfahrzeugen und an Baumaterialien zu
erkennen, während Mädchen sich häufiger mit Puppen und Stofftieren
beschäftigen. Toben, Raufen, expansive, laute und grobmotorische Spiele mit
Wettkampfcharakter, riskante Spiele und Durchsetzungsverhalten werden als
typisch für Jungen eingeordnet. Spiele mit hohen fürsorglichen und
pflegerischen Anteilen und kooperative Spielformen gelten als typisch für
Mädchen.
Im Bereich der Intelligenz sowie
der Fähigkeiten und Fertigkeiten sind bei Mädchen und Frauen feinmotorische
Fertigkeiten sowie verbale Kompetenzen stärker ausgeprägt, bei Jungen und
Männern liegt dagegen ein Vorsprung im räumlich-visuellen Vorstellungsvermögen
und im quantitativ-mathematischen sowie im analytischen Denken vor. Auch im
Sozialverhalten gibt es Unterschiede: Während für Jungen und Männer Konkurrenz
und Dominanz und in diesem Rahmen die Selbstdarstellung eine große Rolle
spielen, wird bei Mädchen ein eher prosoziales Dominanzverhalten
festgestellt. Egalitäre Strukturen sind Mädchen in der Regel wichtiger als
hierarchische Strukturen. Jungen organisieren sich eher in Cliquen mit einiger
Durchlässigkeit, während bei Mädchen meist eine enge Bindung an eine Freundin
zu beobachten ist. Entsprechend tauschen sich Mädchen über persönliche und
emotionsbesetzte Themen aus, während Jungen dahingehend orientiert sind, etwas
miteinander zu unternehmen.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied
besteht im Selbstvertrauen. Jungen und Männer neigen zur Selbstüberschätzung, Mädchen
und Frauen dagegen schätzen ihre Fähigkeiten eher zu niedrig ein. Diese
Selbsteinschätzung wird trotz gegenteiliger Testergebnisse beibehalten und
führt zu unterschiedlichen Reaktionen gegenüber schwierigen Aufgabenstellungen.
Jungen und Männer trauen sich schwierige Aufgaben zu und nehmen sie in Angriff,
auch wenn geringe realistische Chancen zu ihrer Bewältigung bestehen. Mädchen
und Frauen dagegen sind sehr schnell bereit, einen Misserfolg als Ausdruck
ihrer mangelnden Kompetenz einzuschätzen und infolgedessen ihr Anspruchsniveau
zu senken oder ganz aufzugeben. Insbesondere durch diesen Unterschied in
Kombination mit der unterschiedlichen Durchsetzungsfähigkeit kommt es zu
Disparitäten der Geschlechter in Konkurrenz- und Leistungssituationen, die den
Mädchen und Frauen den Zugang zu bestimmten Fächern und Feldern der Arbeitswelt
erschweren.
Hervorzuheben ist, dass es keine
Eigenschaft gibt, die nur bei einem Geschlecht existiert. So gibt es Mädchen
mit mathematischer Begabung, die den Schnitt der Jungen in diesem Punkt weit
übertreffen, und die Legion der Dichter und Schriftsteller dürfte Beweis genug
sein, dass verbale Kompetenzen nicht die alleinige Domäne des weiblichen
Geschlechts sind. Alle Fähigkeiten und Kompetenzen, die als typisch weiblich
oder typisch männlich bezeichnet werden, sind auch beim Gegengeschlecht zu
beobachten und bei gegengeschlechtlichen Individuen oft stärker ausgeprägt als
beim statistischen Durchschnitt des Geschlechts, das hier seinen Kompetenzschwerpunkt
hat. Doch trotz der statistischen Überlappungen hat sich in den meisten
Kulturen eine Polarisation der Geschlechter herausgebildet, die in geschlechtsspezifische
Berufswahlen und Aufstiegsmöglichkeiten mündet und es insbesondere Mädchen und
Frauen zur Zeit schwer macht, einen gleichberechtigten Zugang zu manchen
Berufsfeldern zu finden. Dies gilt z. T. für den Bereich der
Naturwissenschaften, insbesondere aber für alle Berufe, die mit Technik zu tun
haben.
Im Folgenden soll kurz dargestellt
werden, wie diese Disparitäten wissenschaftlich erklärt werden.
Wissenschaftliche Erklärungsansätze
Sozialisationsforschung
Die Sozialisationsforschung der
letzten 30 Jahre geht davon aus, dass die Geschlechtsrollen kulturell geformt
werden und den Kindern von ihrer Geburt an als Stereotypen präsentiert werden,
die über unterschiedliche Lernformen dazu beitragen, dass Mädchen und Jungen
sehr schnell unterschiedliche geschlechtsspezifische Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Denkweisen erwerben.
Basierend auf verschiedenen
psychologischen und lerntheoretischen Modellen angefangen vom
tiefenpsychologischen Persönlichkeitsmodell Freuds über verschiedene Lerntheorien
bis hin zu Kohlbergs Modell der Geschlechtsrollenübernahme versucht die
Sozialisationsforschung nachzuweisen, dass Kinder durch Identifikation mit
Bezugspersonen, durch Imitation von Modellen sowie durch die permanente
Verstärkung von geschlechtstypischem Verhalten seitens der erwachsenen
Bezugspersonen stark zur Übernahme stereotypisierter kultureller
Geschlechtsrollen gedrängt werden.
Tatsächlich unterscheiden sich die
Erziehungsziele, die Mütter für ihre Töchter und für ihre Söhne formulieren, in
vielen Aspekten. So stehen Ehrgeiz, Disziplin, Zivilcourage sowie
Technikverständnis und handwerkliche Fähigkeiten bei den Zielen für die Jungen
im Vordergrund, während Hilfsbereitschaft, Haushaltsführung, Zärtlichkeit
sowie Aufgeschlossenheit gegenüber anderen besonders bei Mädchen genannt
werden. Diesem
Ansatz zufolge prägen also die Erwartungen und Verstärkungsmechanismen der
Erwachsenenwelt das Geschlechtsrollenverhalten von Mädchen und Jungen.
Den Aspekt der Selbstsozialisation
betont neben biologischen Begründungen Eleanor Maccoby: Kinder, die von der
Geburt an darauf angelegt sind, alles von ihnen Beobachtete in Kategorien
einzuteilen, nehmen
polarisierend wahr, dass es zwei Kategorien von Menschen gibt, ordnen sich
entsprechend ein und verstärken in der Peer-group gegenseitig ihr
geschlechtskonformes Verhalten. Das
darfst/kannst du nicht, weil du ein Junge/Mädchen bist. Das darf/kann ich,
weil ich ein Junge/Mädchen bin. wäre so die Leitlinie für das Verhalten in der
Gleichaltrigengruppe. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass zunächst
alles, was in Zusammenhang mit dem eigenen Geschlecht steht, als wertvoll und
positiv eingeschätzt wird. Durch die affektive Besetzung erhalten solche
Urteile ein besonders hohes Gewicht und bleiben entsprechend lange haften. Die
tägliche Aufführung der eigenen Geschlechtsrolle, das doing gender, kann
mit dazu beitragen, dass einerseits geschlechtstypische Fähigkeiten eingeübt
werden, andererseits die gegengeschlechtlichen Kompetenzen überhaupt nicht
erworben werden.
Eine Fülle von Untersuchungen in
Bereichen der familiären, vorschulischen und schulischen Erziehung bringt
Belege dafür, dass Teile der Geschlechtsrolle tatsächlich in einem Prozess der
Sozialisation und Enkulturation erworben werden. Nur so können sich
verstärkende Entwicklungen im Verlauf der schulischen Sozialisation wie z.
B. die zunehmende Distanz von Mädchen zu mathematischen und
naturwissenschaftlichen Fächern und Fragestellungen und die daraus
resultierende Polarisierung bei der Besetzung von Berufsfeldern erklärt werden.
Biologische
und ethologische Forschung
Doch reichen diese
Forschungsergebnisse und die zugrundeliegenden Theorien nicht als alleinige
Erklärung aus, denn geschlechtsspezifisches Verhalten ist beim Individuum
bereits sehr früh, also bereits vor dem Einsetzen wesentlicher kognitiver und
affektiver Lernprozesse, zu beobachten, und es findet sich außerdem in
unterschiedlich scharfer Ausprägung in allen menschlichen Kulturen. Diese
Auffassung vertritt die Entwicklungspsychologin und Konrad-Lorenz-Schülerin
Doris Bischof-Köhler. Die von ihr zitierten Beispiele legen nahe, dass auch bei
gegenteiliger Erziehungsintention, wie sie in den Kinderläden der Studentenbewegung
oder in den egalitären Gemeinschaften der israelischen Kibbuzim vorherrschten,
Kinder stark geschlechtstypisches Verhalten aufwiesen.
Ausgehend von der
Evolutionstheorie, die als Ziel allen Lebens die Weitergabe der eigenen Gene
durch Zeugung und Aufzucht überlebensfähigen Nachwuchses ansieht, legt Bischof-Köhler
dar, dass Männer und Frauen infolge ihrer unterschiedlichen biologischen
Ausstattung und der unterschiedlichen Notwendigkeit zur parentalen
Investition im Laufe
von Jahrmillionen unterschiedliche Strategien der Partnersuche und Partnerwahl
entwickelt haben. Beim männlichen Geschlecht entwickelte sich wegen der
Notwendigkeit, um Weibchen zu konkurrieren, eine spezifische
Wettkampforientierung mit der Betonung assertiver Strategien; die
Möglichkeit, die eigenen Gene auf mehrere Weibchen zu verteilen, könnte
außerdem ein räumlich expansiveres Verhalten erfordert haben. Das Weibchen
dagegen, das nur eine begrenzte Zahl von Kindern zur Welt bringen konnte,
musste bei der Partnerwahl selektiver vorgehen. Da es durch die lange
Tragezeit und die anschließende Pflege viel Zeit und Energie in den Nachwuchs
investierte, konnte sich eine höhere Fürsorglichkeit entwickeln. Im Verlauf
der Phylogenese wurden diese unterschiedlichen Schwerpunkte weiter begünstigt
durch eine Arbeitsteilung, die den Frauen die Aufgabe der alltäglichen Versorgung
durch das Sammeln von Früchten und Pflanzen im Nahbereich des Zuhauses und damit
des Nachwuchses zuwies, während die Männer kooperative Arbeitsformen in der
Großwildjagd entwickelten und außerdem Konflikte mit benachbarten Gruppen
austrugen.
So entstand nach Einschätzung
Bischof-Köhlers ein geschlechtsspezifisches Verhaltenspotential, das von den
Kulturen in ihren Stereotypen aufgegriffen wird. Aber diese Stereotypen werden
den Kindern nicht übergestülpt.
Vielmehr legen Mädchen und Jungen
von Geburt an bereits typische Verhaltensweisen an den Tag, die eine
unterschiedliches Interaktionsmuster der Mutter herausfordern. Während z. B.
Jungen nach ihrer Geburt gesundheitlich und emotional labil sind und in den ersten
Monaten hohe Zuwendung fordern, sind Mädchen neuronal weiter entwickelt,
emotional stabiler, pflegeleichter. Später reagieren Mädchen kommunikativer
und fordern die Mutter zu erweiterter Kommunikation heraus.
Bei Männern und Frauen können
unterschiedliche gehirnanatomische Strukturen beobachtet werden. Die
Lateralisierung des Gehirns ist bei Männern deutlicher ausgeprägt als bei
Frauen, deren Gehirn eher bilateral organisiert zu sein scheint. Das
weibliche Corpus Callosum enthält deutlich mehr Nervenbahnen als das männliche,
diese wiederum begünstigen den Austausch zwischen den Gehirnhälften. Nun
könnte eine unterschiedliche Gehirnanatomie auch das Ergebnis
jahrtausendelanger Sozialisation sein. Doch wurde nachgewiesen, dass durch
hormonelle Einflüsse, insbesondere Androgene, die in der pränatalen Phase
ausgeschüttet werden, nicht nur die Morphologie der Geschlechtsorgane von
Jungen beeinflusst wird, sondern auch Gehirnstrukturen und damit Verhaltensdispositionen
in Richtung von Konkurrenz und aggressiver Konfliktbewältigung, verbunden mit
erhöhten räumlich-visuellen Kompetenzen. Auch könnten hier unterschiedliche
Denkstile der Geschlechter ihren Ursprung haben. Während Jungen eher funktional
und prozessorientiert denken, also Informationen mit einem Zweck oder einer
Funktion verbinden, ist bei Mädchen prädikatives und statisches Denken, ein
Denken in Form von Relationen, Klassifizierungen, begrifflichen Verknüpfungen
stärker zu beobachten. Die kognitive Strategie von Jungen besteht eher im interaktiven
Ausprobieren mit Zwischenlösungen, während Mädchen zunächst versuchen, das
ganze Problem mit allen Aspekten zu verstehen. Auch dies führt Bischof-Köhler
zurück auf die unterschiedlichen phylogenetischen Funktionen, bei denen Frauen
den ganzen Haushalt und die Bedürfnisse aller Mitglieder einschließlich vieler
Nebensächlichkeiten im Blick haben mussten, während sich Männer es sich eher
leisten konnten, dieses Umfeld auszublenden, um sich auf ein Teilproblem zu
konzentrieren.
Mit der Feststellung
unterschiedlicher kognitiver Strategien darf keine Wertung verbunden sein.
Bischof-Köhler vermutet jedoch, dass die herkömmliche Mathematikdidaktik und
die generell verwendeten Tests eher auf männliche Strategien hin konzipiert
sind und es dadurch Mädchen erschweren, ihre Fähigkeiten auszubauen.
Unterschiedliche Begabungsschwerpunkte die durch Förderung ohne weiteres zu
kompensieren sind und Lernangebote, die der eigenen Denkstrategie nicht
angepasst sind - dies in Verbindung mit dem geschlechtsspezifisch deutlich
unterschiedlich ausgebauten Selbstvertrauen und
gesellschaftlichen Pauschalurteilen, die Frauen weniger Erfolgschancen
zuschreiben - münden
in eine sukzessive Benachteiligung von Mädchen im Prozess schulischen Lernens
in den Fächern Mathematik und Physik. Unterstützt wird dies noch durch
unterschiedliches Verstärkungsverhalten von Erziehenden gegenüber Mädchen und
Jungen. Dieses führt Bischof-Köhler jedoch nicht, wie bisher die feministische
Sozialisationsforschung, darauf zurück, dass den Mädchen wegen eines
diskriminierenden Frauenbildes generell weniger zugetraut wird. Im Gegenteil:
Da Mädchen sich von Anfang an verhältnismäßig pflegeleicht und unterstützend
zeigen, trauen ihnen Eltern und Lehrer mehr zu und loben sie bei vielen als
selbstverständlich eingeschätzten Leistungen nicht. Da sie in ihrem
Arbeitsstil, in Fleiß und im Betragen meist unauffällig sind, erhalten
Mädchen Tadel überwiegend für intellektuelle Fehler. Jungen dagegen werden in
allen Bereichen getadelt, doch am häufigsten für intellektuelle Leistungen
gelobt. Mädchen nehmen sich eben wegen ihrer genetisch verankerten sozialen
und moralischen Kompetenz - Tadel
deutlich mehr zu Herzen. So ergeben sich für beide Geschlechter aus den
unterschiedlichen Gesamtbilanzen von Lob und Tadel unterschiedliche
Auswirkungen auf das Selbstgefühl, mit einem positiven Effekt bei den Jungen
und einem negativen bei den Mädchen. Obwohl
Mädchen zunächst positiver bewertet werden, resultieren am Ende ein negativeres
Selbstbild und u. U. schwächere Leistungen.
Wenn die Geschlechter so z. B.
in koedukativen Situationen, später dann auch in der Arbeitswelt in
Konkurrenz geraten, ziehen Mädchen und Frauen meist den Kürzeren. In gemischtgeschlechtlichen
Situationen zeigen sich Jungen eindeutig dominant, während
Mädchen unter Konkurrenzdruck gehemmt reagieren. Auch dies
führt Bischof-Köhler auf die biologische Grundausstattung zurück.
Das Gender-Mainstreaming-Prinzip
der Europäischen Union
Auch wenn die Menschen in Jahrmillionen
geschlechtsspezifische Verhaltensdispositionen erworben haben mögen, so
rechtfertigen die unterschiedlichen Begabungsschwerpunkte doch keine
Bevorzugungs- oder Ausschließungsstrategien hinsichtlich bildungsbezogener oder
beruflicher Entscheidungen. In allen EU-Staaten lässt sich eine zunehmende
Berufstätigkeit von Frauen feststellen. Die berufliche Gleichstellung der
Geschlechter hat die EU als ausdrückliches Ziel formuliert. Um sie zu
erreichen, wurde das Gender Mainstreaming-Prinzip in den Amsterdamer Vertrag
der EU vom 1. Mai 1999 aufgenommen und in den beschäftigungspolitischen
Leitlinien von 1999 konkretisiert. Das Prinzip besagt, dass alle Maßnahmen der
EU in den ihr angehörigen Staaten auf ihre möglichen Auswirkungen für beide Geschlechter
hin zu untersuchen und nur dann zu realisieren sind, wenn sie die
Gleichstellung der Geschlechter unterstützen. Von Anfang an müssen in allen
Politikfeldern geschlechtsspezifische Belange berücksichtigt werden.
Angestrebt werden die Gleichrangigkeit der Erwerbsarbeit für und die
Gleichverteilung der bezahlten Arbeit auf beide Geschlechter.
Überlegungen hinsichtlich des pädagogischen Vorgehens in der Technischen
Früherziehung in Kindertageseinrichtungen
Betrachtet man die
unterschiedlichen Dispositionen, Einstellungen, Verhaltensweisen und
Verarbeitungsformen von Jungen und Mädchen, dürfte klar werden, dass Technische
Früherziehung nicht geschlechtsneutral sein kann. Es geht dabei nicht um
Gleichmacherei, sondern
um gleiche Chancen.
In den meisten deutschen
Kindertageseinrichtungen[23] ist
Gender Mainstreaming noch nicht angekommen. Dies ist um so bedauerlicher, als
Kindergartenpädagogik wie kaum eine andere Institution gesellschaftliche
Geschlechterstrukturen in ihren traditionellen Formen abbildet und durch das
tägliche Handeln der Erzieherinnen und Erzieher immer wieder reproduziert, so
dass deren Auswirkungen zumeist verdeckt wirksam sind.
Mehrere Untersuchungen kommen zu
dem Ergebnis, dass in den Tageseinrichtungen für Kinder eine geschlechtsbewusste
Haltung kaum zu beobachten ist. Die meisten Erzieherinnen behaupten von sich,
sie würden Mädchen und Jungen gleich behandeln. Untersuchungen und
Erfahrungsberichte belegen jedoch genau das Gegenteil. Besonders Jungen gegenüber
verhalten sich Erzieherinnen auffallend unsicher, da sie fürchten ihnen nicht
gerecht werden zu können. Jungen bekommen z.B. mehr Aufmerksamkeiten und werden
stärker sanktioniert als die Mädchen, da das Verhalten von Jungen eher als
Störung wahrgenommen wird. Mädchen werden dagegen als unauffälliger und
angepasster wahrgenommen. In Stuhlkreisen z.B. werden Jungen eher angesprochen
und zum Sprechen ermutigt als Mädchen.
Ursula Rabe-Kleberg weist in ihrer
Analyse des Kindergartens auf die besonderen Schwierigkeiten im Zusammenhang
mit Gender Mainstreaming umfassend hin. Geschlechtsbewusstes, reflektiertes
Handeln ist demnach in Kindertageseinrichtungen selten anzutreffen. Als Folge
dieser Situation gibt es in Deutschland auch kein schlüssiges Gender
Mainstreaming-Konzept für Kindertageseinrichtungen.
Eine der wichtigsten
Voraussetzungen für die Initiierung von Genderprozessen in Kindertagesstätten,
darin sind sich alle Autorinnen und Autoren einig, ist die Entwicklung von Genderkompetenz
bei den pädagogischen Kräften. Damit ist die Fähigkeit gemeint, "Genderwissen"[24]
aufzunehmen und in der pädagogischen Arbeit fachlich kompetent umzusetzen.
Gleichzeitig ist die Entwicklung
einer geschlechtsbewussten, reflektierten Grundhaltung als Querschnittsaufgabe
für die Arbeit mit Kindern ein wichtiger Schritt hin zur Erarbeitung von
Handlungskonzepten, die den Blick auf die unterschiedlichen Lebenswelten von
Mädchen und Jungen schärfen. Dabei ist es wichtig, die Kinder in ihrem Bemühen
zu beobachten und zu unterstützen, ihre Identität als Mädchen und Junge zu
konstruieren. In diesem Prozess des doing gender muss vermeintlich Eindeutiges,
Selbstverständliches immer wieder neu in Frage gestellt und müssen die Handlungsmöglichkeiten
von Mädchen und Jungen erweitert werden.
Dies gilt insbesondere für den
Bereich der technischen Früherziehung, da die meisten Erzieherinnen enorme Berührungsängste gegenüber Technik entwickelt haben
und deshalb technikbezogene Themen meiden.
Was ist nun bei gendersensibler technischer Früherziehung zu berücksichtigen?
Wie in allen Maßnahmen der EU die
Auswirkungen auf beide Geschlechter vorab bedacht werden, ist auch bei jedem
Projekt, bei jeder Einrichtung neuer Spiel- und Lernbereiche, aber auch im
alltäglichen Umgang mit den Kindern in Kindertageseinrichtungen der Gender
Mainstreaming-Gedanke zur berücksichtigen und zu fragen:
- Existieren in der Einrichtung für die
Geschlechter unterschiedliche Normen und Werte und können diese zu einer
unterschiedlichen Wertschätzung oder zu unterschiedlichen Lern-, Entwicklungs-
und Beteiligungschancen führen?
- Gibt es Beteiligungschancen oder
Zugangsbarrieren (in Bezug auf Aktivitäten, Raum, Zeit), die vom
Geschlecht abhängen?
- Gibt es eine Verteilung der pädagogischen
Aufmerksamkeit nach dem Geschlecht?
- Wird in der Gruppe geschlechtsspezifisch
unterschiedliches Durchsetzungs- und Konkurrenzverhalten, sofern es die
Chancen des anderen Geschlechts mindert, toleriert oder unterstützt?
- Werden den Geschlechtern unterschiedliche
Zugangsmöglichkeiten zu Spiel-, Lern- und Experimentiermitteln und
materialien eingeräumt?
- Ist es erforderlich, in bestimmten Lern- und
Spielsituationen auf besondere Stärken und Schwächen oder spezifische
Denkstrukturen eines der Geschlechter Rücksicht zu nehmen?
- Ist es erforderlich, die Mädchen besonders für
den Lernbereich Technik zu motivieren und zu verstärken?
- Ist es sinnvoll, Experimentier- und
Konstruktionssituationen in ihrer Gestaltung auf die jeweiligen Interessen
der Geschlechter zu beziehen?
- Ist es sinnvoll, gelegentlich mit geschlechtsgetrennten
Gruppen zu arbeiten?